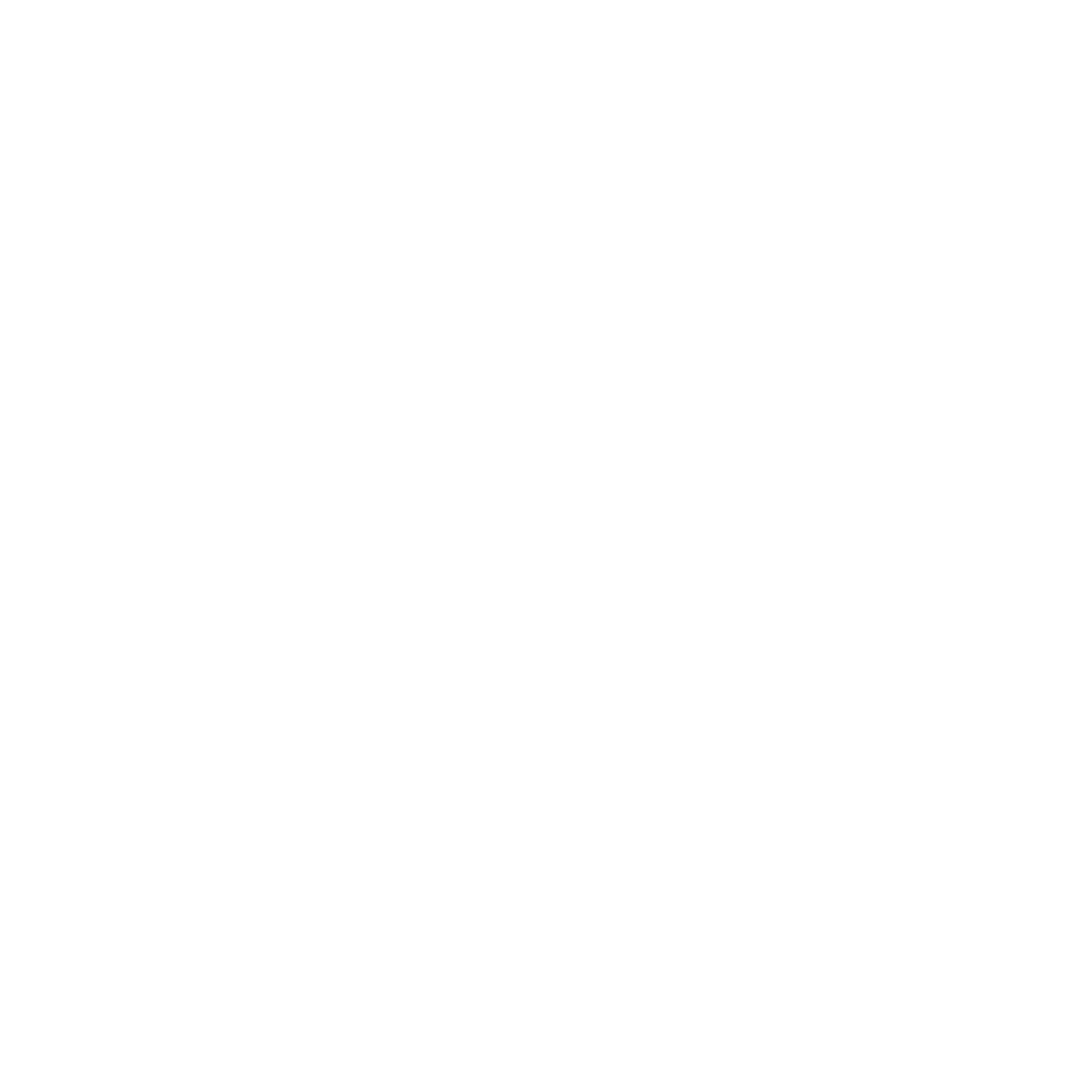Kapitel 1
Peter Wheller, Dr. in Physik und Chemie, war wie an jedem Morgen, so auch an diesem mit seinem alten Volvo in die Uni gefahren. Er hatte sich, wieder mal zum Leid seiner Frau Ashley, eine seiner Kordhosen und ein weißes Hemd angezogen. Da es Ende September etwas kühl geworden war, zog er zusätzlich sein Lieblingssakko darüber, das an den Ellbogen Ledereinsätze hatte, da diese durchgewetzt waren. Mit seinen 43 hatte er schon grau meliertes Haar und weil er häufig Sport machte, war er körperlich in gutem Zustand. Er hatte sich vor einer Woche für den Bostonmarathon im nächsten Jahr angemeldet. Diesmal konnte er wegen einer Tagung nicht mitlaufen, aber 2024 wollte er wieder dabei sein.
Es war jetzt 10:30 Uhr und er unterrichtete einen Teil seiner Studenten in angewandter Physik. Gerade hatte er die Absicht etwas über die Brechung des Lichts zu erklären, da ging die Tür zum Lehrsaal auf und Francis Knight, einer der Leaderships der Uni, kam mit einem besorgten Gesicht herein. Die beiden waren Freunde.
„Peter, kannst du bitte mal rauskommen?“
„Was gibt es?“, fragt dieser etwas verärgert, weil er es nicht ausstehen konnte, in seinen Vorlesungen unterbrochen zu werden.
Francis hatte wiederum die Angewohnheit, einfach mal reinzuschauen, um ihn irgendwas zu fragen, wo Peter sich auskannte und wo er mehr dessen Fachwissen vertraute als Google oder Wikipedia.
„Es ist wirklich wichtig, und es geht nicht anders“ konterte Francis.
Also ging er mit ihm hinaus auf den Gang. Dort standen zwei Männer in Anzügen. Kleidungsstücke von der Stange, was ihn nicht störte, aber ihm sagte, es könnten Polizisten sein. Und so war es auch. Einer der beiden zeigte ihm seine Marke und meinte: „Hallo, mein Name ist Chester Doyle, Detective der Bostoner Polizei, sind Sie Dr. Peter Wheller?“
„Ja“, antwortete er.
Der zweite Ermittler sprach kein einziges Wort und schaute nur teilnahmslos in die Luft. Er war der jüngere und offensichtlich in Ausbildung. Peter ging durch den Kopf: „Wenn er so teilnahmslos bleibt, wird er nicht wirklich ein erfolgreiches Gespräch führen können“.
Gleichzeitig machte er sich darüber Sorgen, was die beiden von ihm wollten. Detective Doyle kam gleich zum Punkt: „Herr Dr. Wheller, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Frau vor etwa einer Stunde einen tödlichen Unfall auf der Alster Street hatte.“
Peter meinte, sich verhört zu haben. Ashley sollte tot sein?
„Nein, das kann nicht sein. Das stimmt nicht, das glaube ich nicht!“, kam es aus ihm heraus.
„Leider doch. Herr Wheller, wir sind fast zu hundert Prozent sicher, aber Sie müssten mit uns mitkommen und bestätigen, dass es Ihre Frau ist.“, antwortet Doyle.
„Ich kümmere mich schon um deine Studenten, gehe du mit den beiden mit“, hörte er Francis sagen und ging wie in Trance mit den Ermittlern mit.
Kapitel 2
Peter wurde von Detective Doyle in einen langen Gang entlang geführt, der mit Neonleuchten erhellt wurde. Den Boden zierte ein grässlicher Linoleumbelag, in hellgrauer Farbe. Nachdem sie kurz zuvor in der Tiefgarage des Bostoner Polizeihauptgebäudes ausgestiegen und mit dem Lift in das Kellergeschoss gefahren waren, marschierten sie jetzt auf eine Tür am Ende des Ganges zu. Schon darauf zugehend ergoss sich ein Schauer über seinen ganzen Körper; nicht nur weil durch das Neonlicht alles kalt wirkte, sondern auch, da es sehr stark nach Desinfektionsmittel stank. Doyle und sein Kollege wirkten aber so, als würden sie täglich diesen Gang entlang gehen.
Nachdem sie durch eine große Tür gegangen waren, auf der Gerichtsmedizin stand, waren sie jetzt in einem Raum, der so aussah, wie man es von Krimiserien aus dem Fernsehen kannte. An der Rückwand waren rechteckige Türen aus Stahl, in denen man die Toten in Kühlboxen verstaute. Davor gab es drei Tische aus Edelstahl, worauf Leichen obduziert wurden. Auf zwei von ihnen lag jemand, jeweils mit einem weißen Tuch bedeckt. Sonst schaute alles aufgeräumt aus und es roch ausgeprägt nach Desinfektionsmittel. Kein Geruch von etwas Verwestem oder anderem. Rechts und links standen Stahlkästen, in denen die Arbeitsgeräte verstaut waren. Rechts neben der Tür durch die sie gerade gekommen waren befanden sich gleich drei größere Waschbecken. Auf mehr Details achtete Peter nicht, aber anscheinend hatte der Gerichtsmediziner noch nicht mit der Autopsie angefangen und auf sie gewartet.
Der Arzt stellte sich mit Dr. Fracer vor und führte sie zu der ersten zugedeckten Leiche. Nachdem er Peter gefragt hatte, ob er bereit sei, eine Frage, die ihm etwas absurd vorkam, denn wie könnte man schließlich für eine solche Situation bereit sein, und er genickt hatte, hob er das Tuch hoch und legte das Gesicht frei.
Peter spürte einen Stich im Herzen, als er da wirklich Ashley auf dem Tisch liegen sah. Ihre kleinen Falten um die Mundwinkel, weil sie fast immer lachte und die kleine Sommersprosse auf der linken Halsseite in Form eines Mickeymauskopfs waren schon genug Beweis für ihn, auch wenn das Gesicht bis zu einem gewissen Grad verschwollen und zerschnitten war. Es gab keinen Zweifel für ihn, es war Ashley, und schon kullerte eine Träne aus seinem rechten Auge und lief ihm die Wange hinunter. Dr. Fracer hatte nicht angefangen, Ashley zu reinigen. So war ihr sonst schulterlanges schwarzes Haar teilweise mit Blut verschmiert und klebte zusammen.
Mit einem Mal hörte er neben sich die Stimme von Doyle fragen: „Dr. Wheller, ist das Ihre Frau?“.
„Ja..a.“, kam es gebrochen aus dem Mund von Peter. „Darf ich einen Moment mit meiner Frau alleine sein?“, fragte er darauf und Doyle sowie der Arzt nickten und alle drei, auch der junge Detective, verließen den Raum.
Jetzt als er mit Ashley für sich war, erinnerte er sich an die verschiedensten Erlebnisse aus ihrem gemeinsamen Leben. Als er sie am Campus von der Universität von Kalifornien in San Francisco kennengelernt hatte. Er beabsichtigte damals, das Frisbee aufzufangen, das sein Studienpartner geschossen hatte, und rempelte Ashley dabei an, weil sie in Gedanken versunken querfeldein über die Wiese des Campus zu ihrem Zimmer im Studentenheim schlenderte. Er lud sie daraufhin zu einem Kaffee ein und so funkte es zwischen beiden.
Dann, die Zeit als er wieder in Harvard war, denn er hatte nur ein paar Austauschseminare in San Francisco besucht. Und wie er sich immer freute, wenn von ihr ein Brief kam. Auch ihre Hochzeit in San Francisco im Fairmont-Hotel kam ihm gleich in den Sinn, welche Ashleys Familie organisierte. Sie gefiel ihnen gar nicht, weil sie zu protzig war. Kurz darauf bekam Peter seine erste Anstellung in Harvard als Assistent, und so zogen sie gemeinsam nach Boston. Ashley eröffnete ihre eigene Praxis für Frauenmedizin. Sie lebten deswegen sehr lange Zeit in einer 25 Quadratmeterwohnung und sparten, wo es nur ging, um ihre Schulden zurückzuzahlen. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Peter kam der Gedanke hoch, wie oft sie am Sonntag am Ufer der Quinzy Bay mit einem Kaffeebecher in der Hand spazieren gegangen waren und Ashley Seemöwen gejagt hatte.
Da öffnete sich die Tür im Hintergrund und Detective Doyle kam mit einem Polizisten in Uniform herein und sagte: „Entschuldigen Sie Dr. Wheller, das ist Inspektor Krout. Er wird Sie nach Hause bringen, sobald Sie so weit sind“.
„Ich bin jetzt so weit“, antwortete Peter und ging Richtung Tür.
Kapitel 3
Die nächsten drei Tage verbrachte er damit, die Beerdigung seiner Frau zu organisieren und ihren Tod zu verstehen.
Am Ende der Woche kam Detective Doyle zu ihm, um ihm zu erklären, dass man aus dem Unfall und dem Tod seiner Frau nicht wirklich schlau würde. Ein Zeuge, der den Aufprall des Autos gehört hatte und deswegen aus dem Fenster schaute, sah nur, wie sie durch die Frontscheibe nach draußen katapultiert wurde. Was er nicht sah, war ein Fahrer oder Mitfahrer, obwohl die Position wie Ashley aus dem PKW geschleudert wurde, eher darauf schließen ließ, dass sie auf den Beifahrersitz gesessen hatte. Außerdem war das Auto, ein alter VW Käfer Baujahr 1961, vom Aufprall so zusammengepresst, dass die Türen nicht mehr zu öffnen waren. Es hätte niemand aussteigen und fliehen können. Und durch die Windschutzscheibe war der Weg durch den Körper von Ashley verlegt. Das Fahrzeug hatte wegen des Alters keine Airbags. Der Wagen war ein Geschenk ihres Großvaters zu ihrer bestandenen Führerscheinprüfung mit 16 gewesen. Es schaute alles so aus, als ob sie sich alleine im Fahrzeug befunden hätte, auch wenn die Position des Körpers auf der Motorhaube was anderes sagte. Routinemäßig fragte er Peter, ob sie an jenem Morgen mit jemandem verabredet gewesen war, der mit ihr im Auto gesessen haben könnte. Er musste das verneinen, denn Ashley wollte an diesen Vormittag gar nicht aus dem Haus. Um 10:30 Uhr sollte ihre Gymnastiklehrerin kommen. Die hat aber vor verschlossenen Türen gestanden und ist nach mehrmaligem Klingeln und telefonischen Versuchen, seine Frau zu erreichen, wieder gegangen, was er tags darauf von dieser erfuhr. Eine weitere Frage war, ob sie unter Depressionen gelitten und deswegen vielleicht Selbstmord begangen hätte? Denn der Wagen war doch mit fast 70 km/h und ungebremst in den Baum gefahren. Das ärgerte Peter im ersten Moment, aber Doyle musste diese Frage stellen. Darüber konnte er nur feststellend sagen, dass dies nicht der Fall war, und sie am Morgen noch fest zu dem Lied „Dancing Queen“ von ABBA, das über Radio lief, mitgesungen und getanzt hatte, sie also in bester Stimmung gewesen ist. Alles zusammen Grund genug für Doyle, und weil auch die anderen Nachforschungen nichts ergeben hatten, nach einer Woche die Untersuchungen des Falles einzustellen.
Francis meinte beim Begräbnis, dass er sich eine Auszeit nehmen sollte, bevor er wieder unterrichten würde. Die Zeit nutzte er, sich mit der Akte, die zum Unfall seiner Frau angelegt worden war, zu beschäftigen. Zuerst wollte man ihm die Autopsie Daten und Bilder nicht aushändigen. Karl Fressen, ein Richter am Gericht von Boston, den er kannte, gab ihm dann einen Beschluss, der die Gerichtsmedizin und die Polizei verpflichtete, ihm alles auszuhändigen, was es zum Fall seiner Frau gab.
Zuerst las Peter die Berichte durch, aber hier konnte er nichts neues entdecken. Der Polizeibericht schloss zwar mit ein, dass der Unfallhergang Rätsel aufgab, welche man allerdings, nicht logisch erklären könne, weswegen der Fall abgeschlossen sei. Der Autopsiebericht von Dr. Fracer ergab, dass der Tod durch innere Blutungen und eine starke Hirnschwellung erfolgt war. Dann fing er an, sich die beiliegenden Bilder genauer anzuschauen. Die von der Unfallstelle zeigten nur das zerstörte Auto aus verschiedenen Richtungen. Nichts, was gezeigt hätte, warum es zu dem Unfall gekommen ist.
Also begann er, die Bilder zu betrachten, die man von dem Körper seiner Ehefrau angefertigt hatte. Auch hier fiel ihm zunächst nichts auf, bis er plötzlich an der rechten Halsseite seiner Frau etwas sah, das so wie eine kleine Beule aussah. Er war im Arbeitszimmer und fing an, in den Laden seines Schreibtisches nach einer Lupe zu suchen, obwohl er wusste, dass er keine hatte. Er schüttelte seinen Kopf wegen seiner Handlung, nahm das Foto und legte es in seinen Scanner, der daneben auf einen Extratisch stand, und scannte es damit ein. Da er seinen Computer immer angeschaltet hatte, erschien kurz darauf die Fotografie am Bildschirm seines Monitors. Er suchte nach der Zoomeinstellung und nachdem er sie endlich oben rechts fand, ließ er die Fotoaufnahme auf 300% vergrößern. Da jetzt nur mehr ein Teil der gesamten Aufnahme gezeigt wurde, scrollte er zu der Stelle, wo er zuvor die Schwellung gesehen hatte. Wirklich richtig zu sehen war immer noch nichts. Bei 600% schien es dann ein kleines Loch in der Mitte der Wölbung zu geben, nur konnte man das nicht mit Gewissheit sagen, da der Bildabschnitt jetzt grobkörnig dargestellt wurde. Da es schon Mitternacht war, beschloss Peter, erst morgen zu einem seiner Kollegen an die Uni zu fahren, der, wie er ihn kannte, eine Software hatte, die das Bild in dieser Größe scharf darstellen würde.
Für alle die ein Kindle von Amazon haben, ihr bekommt die Leseprobe direkt HIER auf Amazon.
Hier erhältlich:
exklusiv bei AMAZON als Ebook, Gebundene Version und als Taschenbuch erhältlich
* Warum das Buch Exklusive auf Amazon? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens wenn man als Autor bekannt werden möchte, dient dazu sehr das KDP-Programm von Amazon. Das bedeutet das der Roman bei Kindle Unlimited und Prime Reading angeboten wird. Eine Voraussetzung das mein Roman bei dem KDP-Programm mitmachen darf, ist, dass es exklusiv auf Amazon angeboten wird. Zweitens, ein Taschenbuch auf anderen Buchplattformen zu verkaufen, bringt fast keine Tantiemen und hat zu lange Druckzeiten, bis zu drei Wochen. Für alle die kein Kindle haben, gibt es die Möglichkeit, dass Buch als Taschenbuch oder gebundene Ausgabe auf Amazon zu kaufen. Dort beträgt die Lieferzeit auch nur drei oder vier Tage.